Rezension: "New Level. Computerspiele und Literatur"
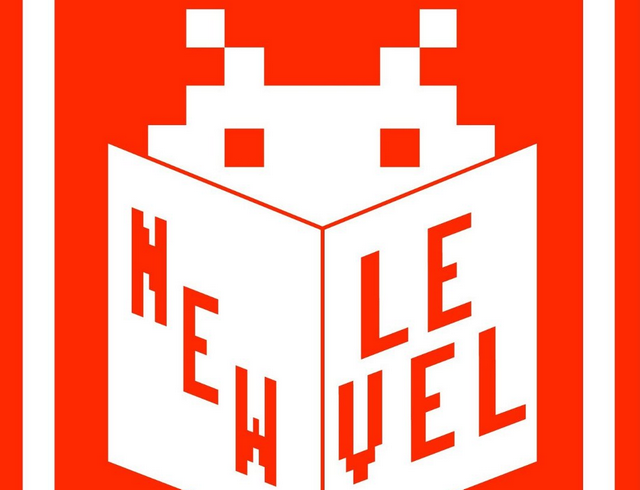
“Shakespeare! Woolf! Murakami! Das sind doch noch Namen! Die sollte man gefälligst im Oberstübchen behalten, und nicht Alcorn, Bunten oder Iwatani!”, säuselt mir manchmal die kritische Stimme meines konservativ schulischen Wissens zu. Es ist so, als würde sie mir sagen wollen, dass Videospiele ja ganz nett seien, aber im Endeffekt wären die literarischen Künste doch höher zu bewerten. Für all jene, die manchmal von einer eben solchen Stimme verfolgt werden, kann ich heute eine Buchempfehlung aussprechen: “New Level. Computerspiele und Literatur”, herausgegeben von Thomas Böhm.
„[E]s ist nötig, ein paar Illusionen zu zerstören, bevor es darum gehen kann, das Lesen als Zugang zu Computerspielen zu rehabilitieren.“
(Christian Huberts, “Computerspiele lesen”, S. 33)
Böhm, der eigentlich Programmleiter des Internationalen Literaturfestivals Berlin ist, konnte eine Vielzahl teils herausragender Autor*Innen für das 26 Texte auf 224 Seiten umfassende Werk gewinnen. Dieses entstand übrigens mitunter aus der Zusammenarbeit des Literaturfestivals mit der Stiftung Digitale Spielekultur. Bevor ich auf einzelne Beiträge näher eingehe, sei schon einmal vorab lobend zu erwähnen, dass die Texte nicht die von mir so arg verhasste, naive Gretchenfrage „Sind Computerspiele die postmoderne Literatur?“ stellen oder gar beantworten möchten. (Da käme eh nur Nonsens bei raus, aber das ist eine ganz andere Baustelle.)
„Das Computerspiel wird nicht durch ein lineares Abscannen von sinnvollen Zeichenkombinationen gelesen, sondern durch das sinnvolle Teilnehmen an und Handeln in einem Regelsystem, das durch seine in Bewegung gesetzten Algorithmen flüchtige Bedeutung generiert. Bloße Nacherzählungen digitaler Spiele zwängen diese dynamischen Aussagen wiederum in einen linearen und statischen Zusammenhang, der nicht repräsentativ für das Computerspiel ist.“
(Christian Huberts, “Computerspiele lesen”, S. 35)
Im Gegenteil: Insbesondere Christian Huberts und Christian Schiffer verstehen es, in ihren Texten “Computerspiele lesen” (Huberts) und “Erdbeeren oder Gnocchetti? Wie Computerspiele Geschichten erzählen” (Schiffer) auf die unterschiedliche Medialität von Computerspielen und Büchern einzugehen. Sie erklären diese prägnant – mal mit einem schärferen, mal mit einem humorvollen Unterton – und zugleich auch für ein fachfremdes Publikum verständlich, ohne aber jemals in einen Modus der Boshaftigkeit oder der Bewertung hinüberzuwechseln.
Vielmehr suchen sie nach den Synergien, die sich aus der gelungenen Verknüpfung beider Elemente ergeben könnten; aber eben nicht zwanghaft. So erhofft sich beispielsweise Schiffer von (zukünftigen) Spielen einen weiteren Schritt in Richtung Lösung des Fledermausproblems, einen globalen Empathie- und Zivilisationsschub quasi. Aber wie bereits gesagt: Es kommt, wie es kommt. Wenn was nicht passt, dann passt’s eben nicht. Ist auch kein Problem. Hätte ja klappen können.
„Wäre Thomas Mann ein Gamedesigner gewesen, wer weiß – vielleicht hätte er dem Spieler die Freiheit gelassen, Gustav von Aschenbach venezianische Gnocchetti kosten zu lassen, statt überreifer Erdbeeren.“
(Christian Schiffer, “Erdbeeren oder Gnocchetti? Wie Computerspiele Geschichten erzählen”, S. 71f.)
Wer nun fürchtet, dass der komplette Sammelband nur aus theoretischen Essays bestehen könnte, darf beruhigt sein: Sie bilden die Ausnahme. Größtenteils versuchten sich die Autor*Innen nämlich daran, eine eigene Spieleidee zu entwickeln und diese zu verschriftlichen (ich fühlte mich dabei übrigens positiv an die “The Games That Never Were”-Rubrik von videogametourism.at erinnert). Während man bei einigen der Gedankenexperimenten eine – zumindest für meinen Geschmack – zu sehr von der literaturwissenschaftlichen Disziplin geprägte Gestaltungsweise erkennen kann, frage ich mich bei den anderen, warum zur Hölle noch nicht längst eine Kickstarter-Kampagne für sie eröffnet wurde. So liest sich die Konzeption von Paul Murrays No Such Place sehr spannend, in welcher versucht wird, bedrohliche Traumszenarien mittels der audiovisuell erfassten Erinnerungen der Spielenden zu gestalten und diese mit einem stetigen Genrewechsel spielmechanisch zu untermauern.
 Oder gar das wundervolle Krimi-Adventure Agent Mnemosyne von Ryad Assani-Razaki, dessen Grundmechanik mich unglaublich reizt: Eine der Figur nahestehenden Personen wird ermordet, wobei dieser Akt ebenfalls der Figur untergeschoben wird. Nach all den Jahren im Gefängnis müssen die Spielenden den Fall selbst aufklären – und zwar mittels der titelgebenden Droge Agent M. Durch das Mischen der Chemikalie mit dem Blut x-beliebiger, anderer Menschen kann man deren Erinnerungen zu einem bestimmten Zeitpunkt nachverfolgen, wenn man sich dieses Gemisch selbst injiziert. Die Figur wird dann quasi zu der anderen Person in der Vergangenheit und kann sich in ihrer Erinnerungssphäre bewegen. Die Interaktionsmöglichkeiten sind dabei jedoch eingeschränkt. Man muss sich in dieser Erinnerung genauso verhalten wie es die reale Person auch in der Vergangenheit tat, ansonsten erleidet die geistige Gesundheit der eigenen Spielfigur einen Schaden. Das Spiel endet, wenn es entweder zur Auflösung des Kriminalfalls oder aber zum kompletten Wahnsinn kommt. Man muss die anderen Menschen also erst einstudieren. Man muss sie lesen lernen. Fantastisch.
Oder gar das wundervolle Krimi-Adventure Agent Mnemosyne von Ryad Assani-Razaki, dessen Grundmechanik mich unglaublich reizt: Eine der Figur nahestehenden Personen wird ermordet, wobei dieser Akt ebenfalls der Figur untergeschoben wird. Nach all den Jahren im Gefängnis müssen die Spielenden den Fall selbst aufklären – und zwar mittels der titelgebenden Droge Agent M. Durch das Mischen der Chemikalie mit dem Blut x-beliebiger, anderer Menschen kann man deren Erinnerungen zu einem bestimmten Zeitpunkt nachverfolgen, wenn man sich dieses Gemisch selbst injiziert. Die Figur wird dann quasi zu der anderen Person in der Vergangenheit und kann sich in ihrer Erinnerungssphäre bewegen. Die Interaktionsmöglichkeiten sind dabei jedoch eingeschränkt. Man muss sich in dieser Erinnerung genauso verhalten wie es die reale Person auch in der Vergangenheit tat, ansonsten erleidet die geistige Gesundheit der eigenen Spielfigur einen Schaden. Das Spiel endet, wenn es entweder zur Auflösung des Kriminalfalls oder aber zum kompletten Wahnsinn kommt. Man muss die anderen Menschen also erst einstudieren. Man muss sie lesen lernen. Fantastisch.
Ebenso grandios ist auch das weitschweifende Interview “Über Geschichte, Gegenwart und Zukunft von Computerspielen” mit Gundolf S. Freyermuth, dem Mitbegründer des Cologne Game Labs. Verschiedene Themen werden dabei informativ angerissen und besprochen, beispielsweise über seine Arbeit als Lab-Leiter, seine Vorfreude auf NPCs, die tatsächlich auf die Spielenden reagieren (und nicht etwa nur auf den Avatar mit all den beschränkten Interaktionsmöglichkeiten) oder über die komplett unterschiedlichen Bedürfnisse, die Film und Spiel befriedigen können. Meine Lieblingsstelle aus dem Interview möchte ich euch dabei nicht vorenthalten:
„Was ist ein Serious Game?“
„Ein unglücklicher Terminus. Das ist die kurze Antwort.“(Interview mit Gundolf S. Freyermuth, “Über Geschichte, Gegenwart und Zukunft von Computerspielen”, S. 129)
Es gäbe noch so viele schöne Lesemomente zu erwähnen. Die atmosphärische Dichte der vermittelten, von Schmerzmitteln durchsetzten Kindheitserinnerungen in Shane Andersons Beitrag “Deception Island”. Jan Drees’ vor fiktiven Technik-Ausdrücken strotzenden Handbuch-Text “Comfort Lounge 2.0”, bei dem ich mir unsicher bin, ob er seine Wirkungskraft mittels einer ironischen oder einer Meta-Ebene (oder gar beides?) entfaltet. Wladimir Kaminers Vorschlaghammerhumor in “Je oller dosto jewski: Schuld und Sühne (Ego-Shooter)”, wo er erklärt, wieso Deutschland eine Oma-Republik ist und inwiefern eine Axt dagegen helfen könnte.
Und natürlich darf ich diesen einen Text nicht vergessen… Allein für dieses letzte Zitat, mit dem ich diese Rezension nun beenden möchte, lohnt es sich, das Buch zu kaufen. Diese Worte stellen den textuellen Brückenschlag zwischen Programmierung und Poetik dar, den ich ab sofort immer in meinem Gedächtnis behalten möchte:
„In den Programmiersprachen sind diese Wiederholungen verdichtet worden zu Schleifen-Befehlen. Sie sind die Refrains, die aus Algorithmen Heldenlieder machen oder uns jedenfalls die Nähe zu den uralten Formen des Langgedichts spüren lassen. Auch die mächtigen “reservierten Worte” der Codes decken sich mit Bedeutungspotenzialen der klassischen Lyrik, in der ein Begriff wie “Rose” nicht einfach für eine rote Blume steht, sondern eine Mannigfaltigkeit von Interpretationsmöglichkeiten um sich hat.“
(Peter Glaser, “Gilgamesh”, S. 190)