Ludum Dare 32: South

Die Menschheit hat wirklich schon viel über den Krieg geschrieben. In all diesen Wirren aus Betroffenheit und falsch verstandenem Pazifismus fehlt stets eine entscheidende Erkenntnis: Wir können Krieg überhaupt nicht begreifen. Wir, das sind die europäischen Nachgeborenen, die in ihrem Leben noch nie erleben mussten, wie Massen von Menschen aufeinander schossen, Bomben warfen und Monstrositäten aus Stahl konstruierten, um damit noch größer, besser und lauter aufeinander zu schießen. Ausgenommen sind lediglich Kriegsberichterstatter, Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und natürlich die Soldaten höchstselbst.
Unsere Auseinandersetzung mit dem Krieg hat daher eine abstrakte zu sein. Wir können nicht den Versuch unternehmen, das Grauen zu beschreiben oder gar uns in das hineinversetzen, was Menschen im Krieg erleben. Was wir schon können: uns in einen pixeligen Fuchs verwandeln, eine Wand vollschmieren, dann auf einen Wachturm steigen und nachsehen, wo die Bomben runterkommen. Genau das macht der Spieler nämlich in South, dem Ludum-Dare-Beitrag von Edu Verzinsky, der sich in Sebastian Standkes Porträt-Reihe zum Game Jam selbst einen Underground Developer nennt.
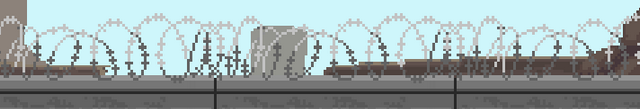
South besteht aus einem Schlachtfeld, einer Mauer mit Stacheldraht drauf und zwei Wachtürmen. Der Fuchs in der Hauptrolle ist lediglich mit einer Sprühdose bewaffnet und kann die Mauer bemalen. Dort wo er seine Punkte macht, prasseln schließlich auf dem Schlachtfeld auch die Bomben nieder und zermalmen hoffentlich all die anrückenden Panzer und Truppen. Denn in South herrscht permanenter Krieg. Der Norden ist mit dem Süden im Krieg und der Osten mit dem Westen. Dieser Krieg ändert sich nicht nur nie, er hört auch nie auf.
Was uns Verzinsky sagen will? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht ist South eine einzige Anspielung darauf, dass Krieg für uns inzwischen zu etwas Abstraktem und Unpersönlichem geworden ist. Kriegführende Nationen setzen heute Punkte auf strategischen Karten und beobachten dann, was passiert, wenn für den Radar unsichtbare Bomber die Ziele pulverisieren. Mit Terrorgruppen wie dem Islamischen Staat ist Krieg andererseits heute so persönlich wie lang nicht mehr – in Zeiten, in denen Irre aus religiösem Wahn anderen vor laufender Kamera den Kopf abschneiden, können wir wahrlich nicht von einem unpersönlichen Krieg sprechen.
Vielleicht soll uns South aber auch etwas ganz anderes sagen. Dass es nicht professionell ist, über Krieg zu schreiben, wenn man keine Ahnung davon hat, beispielsweise. Dass es sinnlos ist, sich zu überlegen, wie sich Menschen im Krieg wohl fühlen. Meine Magister-Arbeit schrieb ich seinerzeit über den Afghanistan-Krieg. Monatelang habe ich versucht, herauszufinden, wie es wohl so ist, im Krieg zwischen Taliban und US-Armee. Am Ende standen nüchterne Erkenntnisse, aber kein besseres Verständnis. Ich fühlte mich machtlos.